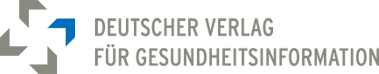Belastungsstörungen sind direkt verursacht durch eine einmalige schwere Belastung (Trauma) wie
- eine Naturkatastrophe,
- das Erleben einer Gewalttat,
- eine Vergewaltigung o.ä.
oder auch durch längerdauernde schwere Belastungen (z.B. längerer sexueller Missbrauch). Die Symptomatik solcher übermäßigen Reaktionen auf Belastung kann sehr unterschiedlich ausfallen.
Grundsätzlich ist es normal, dass Traumata oder schlimme Lebensereignissen Traurigkeit, Angst, Schrecken, Schlafstörungen etc. hervorrufen. Als psychische Störung werden solche Reaktionen erst dann bezeichnet, wenn
- sie „normale“ Reaktionen erheblich übersteigen und
- mit deutlichem Leid und/oder Verminderung von Leistungsfähigkeit verbunden sind.
Als akute Belastungsreaktion wird eine Symptomatik bezeichnet, die in den Stunden unmittelbar nach einem belastenden Ereignis auftritt. Nach maximal 48 Stunden klingt sie wieder ab („Nervenzusammenbruch“, psychischer Schock).
Dabei treten Gefühle der inneren Leere, Verzweiflung und Angst, u.U. auch Suizidgedanken auf. Es ist wichtig, Betroffene nicht alleine zu lassen und sie bei ihrer Stabilisierung zu unterstützen („Krisenintervention“).
Bei Anpassungsstörungen treten unterschiedliche Symptome wie Angst, Sorgen und Anspannung auf. Sie bringen dem Betroffenen starkes Leid. Anpassungsstörungen beginnen innerhalb eines Monats nach dem auslösenden Ereignis und dauern maximal mehrere Monate.
Auslösende Ereignisse können akute Ereignisse wie der Tod oder die schwere Erkrankung eines Angehörigen sein. Es kann sich aber auch um länger dauernde Belastungen, z.B. Eheprobleme oder Schwierigkeiten am Arbeitsplatz handeln.
Behandelt werden Anpassungsstörungen vorwiegend ambulant psychotherapeutisch. Neben einer notwendigen Krisenintervention kann auch Unterstützung bei der Verarbeitung des auslösenden Ereignisses sinnvoll sein. Evtl. kann dazu kurzfristig auch ein beruhigendes Medikament verordnet werden.
Fallbeispiel: Anpassungsstörung
Eine 34-jährige verheiratete Mutter von zwei kleinen Kindern stellt sich auf Anraten ihres Hausarztes beim Psychotherapeuten vor. Eigentlich sei es ihr in den letzten Jahren recht gut gegangen, bis ihr vor drei Wochen ihr Ehemann eröffnet habe, dass er über das Internet eine andere Partnerin kennen gelernt habe und sich von ihr trennen wolle. Sie wohnten aktuell noch in derselben Wohnung in getrennten Zimmern, er sei auf Wohnungssuche.
Seit diesem Ereignis fühle sie sich verzweifelt, sei häufig gereizt, habe starke Ängste vor der Zukunft, könne schlecht schlafen und müsse häufig weinen. Sie sei noch in der Lage, ihren Halbtagsjob zu versehen. Das verschaffe ihr sogar etwas Abwechslung und lenke sie ab, genauso wie Treffen mit Freunden. Sobald sie jedoch in der Wohnung sei, treten alle Symptome wieder auf und sie wisse nicht, wie es weitergehen solle.
Die Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) tritt nach schwersten, katastrophalen Belastungssituationen wie Überfällen, Vergewaltigungen oder Folter auf. Als Symptome zeigen sich
- ständiges Wiedererinnern und Wiedererleben des Traumas („Flashbacks“),
- häufig Alpträume,
- zusätzlich eine Vermeidung von Situationen, die daran erinnern,
- Abflachung des emotionalen Erlebens,
- körperliche Übererregung.
Viele Betroffene schämen sich für das Erlebte und die Störung. Deshalb suchen sie oft erst spät oder nie psychiatrische oder psychotherapeutische Behandlung auf. Häufig kommt es auch zum Missbrauch von Alkohol oder Beruhigungsmitteln, um die Symptome selbstständig in den Griff zu bekommen. Das kann eine komplizierte Suchtproblematik nach sich ziehen.
Rund 60 Prozent aller Menschen erleiden im Laufe ihres Lebens ein Trauma. Es erkranken aber nur 5 bis 10 Prozent an einer PTBS. Frauen sind etwa doppelt so häufig wie Männer betroffen. Je nach Art des Traumas ist die Wahrscheinlichkeit für die Entwicklung einer Posttraumatischen Belastungsstörung sehr unterschiedlich:
- ca. 70 Prozent nach Vergewaltigung,
- 35 Prozent nach Kriegseinsätzen,
- 8 Prozent nach Unfällen,
- 5 Prozent nach Naturkatastrophen.

Nach einer Vergewaltigung besteht eine vergleichsweise hohe Wahrscheinlichkeit auf die Entwicklung einer posttraumatischen Belastungsstörung © Tinnakorn | AdobeStock
Die Behandlung einer PTBS sollte vorwiegend psychotherapeutisch erfolgen. Zunächst ist aber Stabilisierung z.B. durch
- Entspannungstrainings,
- angenehme Beschäftigungen oder
- Besinnung auf die eigenen Stärken sowie
- der Abbau von sozialem Rückzug
wichtig.
Im Anschluss ist es häufig sinnvoll, sich mit der traumatischen Situation auseinanderzusetzen, anstatt sie dauernd zu vermeiden. Das kann durch Nacherleben des Erlebten in Gedanken, aber auch durch das Aufsuchen des Ortes des traumatischen Geschehens. Die Psychotherapie kann ggfs. durch eine medikamentöse Therapie mit Antidepressiva ergänzt werden.
Fallbeispiel: Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS)
Eine 24-jährige Studentin wendet sich wg. starker Ängstlichkeit, Schlafstörungen, Gereiztheit und schlechter Stimmung an die Ambulanz einer Fachklinik für Psychosomatik. Diese Symptome bestünden, seit sie vor 4 Monaten beim nächtlichen Heimkommen von einem Unbekannten vor ihrer Wohnung überfallen worden sei. Beim Abschließen ihres Fahrrades habe sie einen schweren Schlag auf den Kopf bekommen. Danach könne sie sich an nichts mehr erinnern bis zu dem Zeitpunkt 25 Minuten später, als sie wieder zu sich gekommen sei. Ihr Geldbeutel sei weg gewesen. Sie habe durch den Schlag und den darauffolgenden Sturz erhebliche Verletzungen erlitten.
Seitdem habe sie ihr Fahrrad nicht mehr berührt, könne nach Einbruch der Dämmerung nicht mehr alleine hinaus und habe ständige Alpträume. Auch tagsüber laufe das Ereignis immer wieder wie im Film ab.
Nach besonders schweren, langanhaltenden und wiederholten Traumata können sich auch dauerhafte Persönlichkeitsveränderungen einstellen. Solche Ereignisse sind etwa
- Folterung,
- gefährlicher Einsatz in Kriegs- oder Katastrophengebieten,
- extreme familiäre Gewalt.
Die Betroffenen fürchten auch nach Ende der Gefahr, dass sich die Ereignisse wiederholen könnten. Sie sind extrem misstrauisch gegenüber ihrer Umwelt. Chronische Schlafstörungen und andere körperliche Beschwerden sind häufige Beschwerden. Manche Betroffene fallen dadurch vollständig aus ihrem bisherigen sozialen Rahmen heraus.