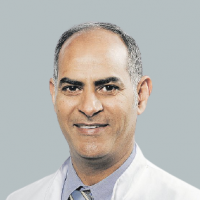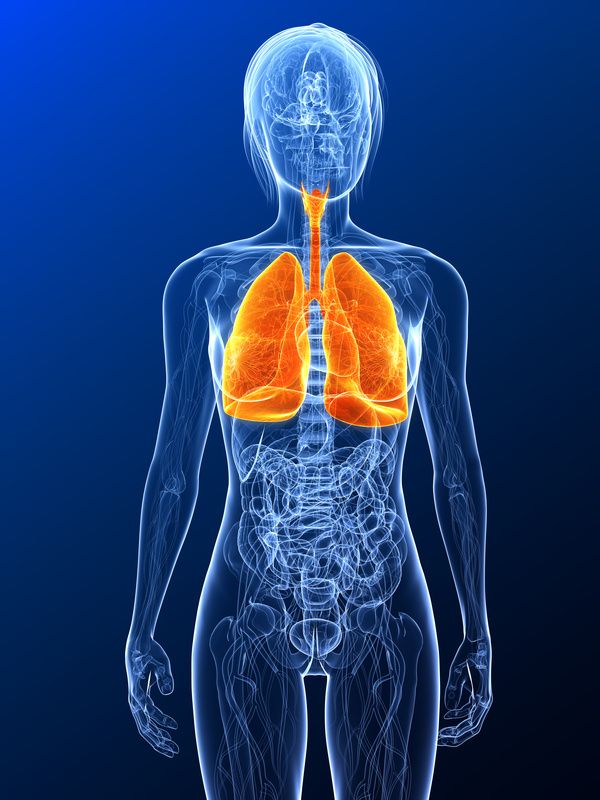Die idiopathische Lungenfibrose (ohne bekannte Ursache) ist die häufigste Form der Erkrankung. Zwischen 14 und 42 Menschen pro 100.000 Einwohner sind davon betroffen. Männer leiden öfter als Frauen an Lungenfibrose. Nur selten diagnostiziert man eine Lungenfibrose bei Personen unter 50 Jahren.
Der bindegewebige Umbau der Lunge bleibt oft über viele Jahre hinweg unbemerkt. Erst wenn ein Großteil des Lungengewebes von der Fibrosierung betroffen ist, macht sich die Erkrankung bemerkbar.
Die Betroffenen stellen fest, dass ihre Leistungsfähigkeit nachlässt und sie nicht mehr so belastbar sind. Selbst bei einfacheren Tätigkeiten im Alltag geraten sie außer Atem und leiden ferner unter trockenem Reizhusten ohne Auswurf. Insbesondere das Einatmen fällt schwer, sodass bei den Erkrankten häufig ein plötzlicher Atemstopp während der Einatmung auftritt.
Im Krankheitsverlauf besteht die Atemnot schlussendlich auch, wenn keinerlei Anstrengungen unternommen werden.
Um den sinkenden Sauerstoffgehalt im Blut auszugleichen, erhöht der Körper die Atemfrequenz. Dadurch wird die Atmung allgemein oberflächlicher und schneller. Man spricht hier auch von einer Hechelatmung.
Eine lang anhaltende Sauerstoffunterversorgung äußert sich durch folgende Symptome:
- Blaufärbung der Haut (Zyanose)
- runde und aufgetriebene Fingerspitzen (Trommelschlegelfinger)
- auffällig vorgewölbte Fingernägel (Uhrglasnägel)
Bei der Fibrose vermehren sich die Bindegewebsfasern innerhalb der Lunge. Dieses zusätzlich gebildete Bindegewebe vernarbt schließlich und beschädigt die Oberfläche der empfindlichen Lungenbläschen. Dadurch nimmt die Dehnbarkeit der Lunge ab und der Gasaustausch innerhalb der Lunge wird beeinträchtigt.
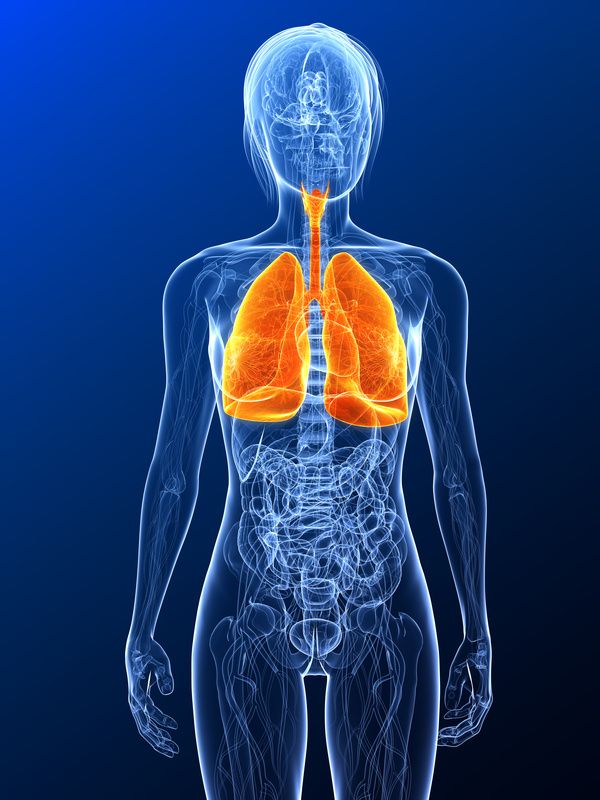
Die Lage der Lunge im menschlichen Körper © Sebastian Kaulitzki / Fotolia
Grundsätzlich kann die Lungenfibrose hinsichtlich ihrer Ursache in zwei Gruppen unterteilt werden:
- Lungenfibrosen mit bekannter Ursache und
- idiopathische Fibrosen, bei denen kein Auslöser erkennbar ist.
Eine Lungenfibrose kann durch Viren oder Parasiten und den Kontakt mit schädigenden Stoffen entstehen.
Das Einatmen schädlicher Substanzen kann Erkrankungen oder allergische Reaktionen sowie später eine Fibrosierung verursachen, zB.
- Asbest oder Kohlenstaub (kann zu einer Staublunge mit Fibrosierung führen),
- Zigarettenrauch,
- verschiedene Allergieauslöser wie Vogelkot oder Pilzsporen,
- Gase wie Schwefeldioxid oder Ammoniak sowie
- Dämpfe und Aerosole.
Sie alle können einen fibrösen Umbau des Lungengewebes begünstigen.
Ferner gibt es Medikamente, die bei regelmäßiger Einnahme zu einer Lungenfibrose führen können. So verursachen
- Bleomycin,
- Carbamazepin und
- Floxuridin
Veränderungen am Lungengerüst und erhöhen das Risiko einer Fibrose deutlich.
Schädigungen am Lungengewebe können auch durch Strahlentherapien bei Krebserkrankungen entstehen. Man spricht in diesem Fall von einer Strahlungsfibrose.
Bestimmte Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises wie die
gehen ebenfalls mit einem bindegewebigen Umbau des Lungengewebes einher.
Zunächst bespricht der Arzt die Symptome mit dem Patienten und erhebt dessen Krankengeschichte (Anamnese). Hat er daraufhin den Verdacht auf eine Lungenfibrose, führt der Arzt verschiedene körperliche Untersuchungen durch.
Zunächst hört er die Lunge mit dem Stethoskop ab (Auskultation). Bei einer Lungenfibrose ist am Ende der Einatemphase ein sogenanntes Knisterrasseln zu hören. Dieses Rasselgeräusch entsteht durch Wasseransammlungen im Lungengewebe. Gelegentlich ist auch ein quietschendes Geräusch zu hören.
Die Lunge kann sich aufgrund der Fibrosierung nicht mehr richtig ausdehnen. Beim Abklopfen (Perkussion) der Lunge fallen deswegen hochstehende Zwerchfellgrenzen auf.
Um die Eigenschaften des Lungengewebes und Gasaustauschs besser beurteilen zu können, führt der Arzt Lungenfunktionstests durch. Dabei wird mithilfe eines sogenannten Spirometers gemessen, wie schnell die Ausatemluft austritt und wie viel Luft in der Lunge mobilisiert werden kann.
Charakteristischerweise zeigen sich bei der Spirometrie und der Untersuchung des Blutes folgende Befunde:
- eine Abnahme des Lungenfunktionsgewebes
- eine verminderte Dehnbarkeit des Lungengewebes
- ein gestörter Gasaustausch zwischen Blut und Lunge
- eine verminderte Sauerstoffsättigung des Blutes (Hypoxämie)
Um das Ausmaß der Erkrankung abschließend beurteilen zu können, ist eine Röntgenuntersuchung erforderlich. Hier zeigen sich in der Regel eine Zeichnungsvermehrung der Lungenstruktur und ein Hochstand des Zwerchfells.
Die Lungenstruktur lässt sich auch mit einer hoch auflösenden Computertomographie erfassen.
Da die Lungenfibrose nur ein Symptom ist, richtet sich die Behandlung nach der Grunderkrankung.
Basiert die Fibrosierung auf dem Kontakt mit Schadstoffen, müssen diese strikt gemieden werden.
Entzündliche Lungenerkrankungen werden hingegen mit Kortisonpräparaten behandelt. Diese wirken nicht nur gegen die Entzündung, sondern auch antiallergisch. Der Patient erhält sie
- in Form von Tabletten,
- als Spray durch Inhalation oder
- intravenös.
Zur Erweiterung der verengten Atemwege erhalten die Patienten ferner sogenannte Bronchodilatoren. Die Arzneimittel entspannen die kleinen Muskeln der Bronchien und erleichtern die Atmung.
Liegt der Lungenfibrose eine bakterielle Infektion zugrunde, wird diese mit Antibiotika wie
- Makroliden,
- Chinolonen oder
- Cefalosporinen
behandelt.
Die aktive Teilnahme an einer Lungensportgruppe kann die körperliche Fitness der Fibrosepatienten verbessern. Dabei führt der Patient unter professioneller Anleitung ein gezieltes Muskel- und Ausdauertraining durch.
Schwere Krankheitsverläufe, bei denen die Lunge den Gasaustausch nicht mehr in ausreichendem Maße leisten kann, erfordern eine Lungentransplantation. Dazu müssen die Patienten allerdings jünger als 60 Jahre alt sein und konsequent auf das Rauchen verzichten.
Durch die Transplantation verbessert sich in der Regel die Lebensqualität. Eine verlängerte Lebenszeit lässt sich jedoch nicht erreichen.
Die Prognose hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu gehören neben dem Zeitpunkt des Behandlungsbeginns auch der Behandlungserfolg und der Umfang der Lungenschädigung.
Grundsätzlich handelt es sich bei der Lungenfibrose um eine schwere Organschädigung. Sie kann nicht geheilt werden und führt bei vielen Patienten zum Tod. Die idiopathische Lungenfibrose weist eine äußerst schlechte Prognose auf: 70 Prozent aller Patienten versterben an dieser Form der Fibrose.
Die durchschnittliche Überlebenszeit nach der Stellung der Diagnose liegt bei drei Jahren. Nach fünf Jahren leben nur noch 20 bis 40 Prozent der Betroffenen.