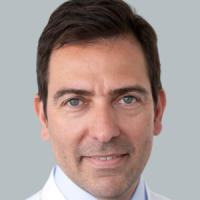Der Hypogonadismus lässt sich entsprechend der Ursachen in drei Formen unterteilen. Beim primären Hypogonadismus findet sich die Ursache direkt in den Keimdrüsen. Die übergeordneten hormonellen Zentren stimulieren Eierstöcke oder Hoden zwar, diese produzieren aber zu wenig Hormone. Eine typische angeborene primäre Störung des Mannes ist das Klinefelter-Syndrom. Menschen mit dieser Erkrankung besitzen statt des bei Männern üblichen XY-Chromosomensatzes ein zusätzliches X-Chromosom.
Ein primärer Hypogonadismus tritt ebenfalls bei Frauen auf, die unter dem Turner-Syndrom leiden. Sie haben anstelle von zwei Geschlechtschromosomen (XX) nur ein funktionsfähiges X-Chromosom. Ebenso können beim Mann Hodentumore oder Verletzungen im Genitalbereich zu einer verminderten Hormonproduktion führen. Bei Frauen kann Eierstockkrebs und/oder eine Entzündung in diesem Bereich eine mögliche Ursache sein.
Der sekundäre Hypogonadismus beruht hingegen auf einer Störung der Hypophyse, die im Hirn als übergeordnetes hormonelles Zentrum fungiert. Sie schüttet das Follikelstimulierende Hormon (FSH) sowie das Luteinisierende Hormon (LH) aus. Diese sogenannten Releasing-Hormone animieren die Keimdrüsen zur Produktion der Geschlechtshormone. Mangelt es also an den Releasing-Hormonen, produzieren Eierstöcke und Hoden zu wenig Testosteron bzw. Östrogen und Progesteron.

Das Hypophysenadenom ist eine typische Erkrankung, bei der ein sekundärer Hypogonadismus auftreten kann. Es handelt sich dabei um einen seltenen, gutartigen Tumor im Kopf. Auch bei angeborenen Störungen, wie beispielsweise dem Kallmann-Syndrom, oder einer direkten Schädigung des Hypophysenvorderlappens kann ein sekundärer Hypogonadismus entstehen. Die seltenste Form des Hypogonadismus, der tertiäre Hypogonadismus, liegt dann vor, wenn die Ursache auf Ebene des Hypothalamus zu finden ist.
Der Hypothalamus ist ein Teil des Zwischenhirns, der ebenso wie die Hypophyse Releasing-Hormone ausschüttet. Diese stimulieren jedoch nicht direkt die Keimdrüsen, sondern die Hypophyse zur Ausschüttung von FSH und LH. Über einen Mangel an diesen hypophyseneigenen Releasing-Hormonen kommt es entsprechend auch zu einer verminderten Keimdrüsenaktivität und einer verminderten Ausschüttung von Geschlechtshormonen.
Die Symptome sind äußerst vielseitig und zeigen sich keinesfalls nur im sexuellen Bereich. Fehlt es bereits im Kindesalter an Testosteron, bleibt die Pubertät aus. Man spricht hier auch vom Eunuchismus. Sowohl die primären als auch die sekundären Geschlechtsmerkmale bleiben in der Entwicklung zurück. Die Betroffenen haben somit ein geringes Hodenvolumen und einen unterentwickelten Penis. Des Weiteren ist die Körperbehaarung eher spärlich. Im Erwachsenenalter können folgende Symptome auftreten:
- Abnahme der Libido
- Verlust der Achsel- und Schambehaarung
- verminderter Bartwuchs
- Abnahme der Körpergröße
- Spontanbrüche durch eine verminderte Knochendichte
- Verlust von Muskelmasse und Kraft

Bei Frauen zeigen sich vor allem
Auffälligkeiten im Zyklus. Besteht die Hormonstörung bereits vor der Pubertät, bekommen die betroffenen Mädchen nie ihre Periode. Man spricht hier von einer
primären Amenorrhoe. Auch im Erwachsenenalter bleibt die Monatsblutung aus
(sekundäre Amenorrhoe). Da kein Eisprung stattfindet, sind Frauen mit einem Hypogonadismus
unfruchtbar.
In einer detaillierten Anamnese kann der behandelnde Arzt mithilfe spezieller Fragebögen alle Symptome erfragen. Häufig zeigen sich hier schon Hinweise auf einen Hypogonadismus. Auch die körperliche Untersuchung liefert hypogonadismus-assoziierte Befunde wie beispielsweise unterentwickelte Geschlechtsteile oder eine verminderte Körperbehaarung. Laborchemische Untersuchungen sind zur Stellung einer sicheren Diagnose jedoch unabdingbar.
Der Arzt bestimmt die Werte der Geschlechtshormone Testosteron, Östrogen, Progesteron, LH, FSH sowie die Konzentration der sogenannten Sex Hormone Binding Globuline (SHBG). Bei Verdacht auf einen sekundären oder tertiären Hypogonadismus müssen die organspezifischen Releasing-Hormone ebenfalls getestet werden. Ein niedriger Hormonspiegel sollte dabei immer durch mindestens eine zweite Messung bestätigt werden, da eine vorübergehende Abnahme auch durch andere akute Erkrankungen bedingt sein kann.
Bei einem spezifischen Verdacht können ferner bildgebende Verfahren wie die Sonographie (Ultraschall) hilfreich sein. Hier lassen sich die Geschlechtsdrüsen strukturell darstellen und beurteilen.
Die Therapie richtet sich nach der Ursache der Hormonstörung. So werden Tumore beispielsweise mit Chemo- oder Strahlentherapie behandelt. Nicht immer ist eine ursächliche Behandlung jedoch möglich. Zur Linderung der Beschwerden erhalten die Patienten dann Hormonpräparate in Form von Tabletten, Cremes, Depotspritzen oder Pflastern.
Da die Hormonersatztherapie Risiken birgt, müssen mögliche Gegenanzeigen vor der Behandlung ausgeschlossen werden. Dazu gehören zum Beispiel hormonabhängige Tumore, eine Überempfindlichkeit gegen künstliche Hormone oder andere Inhaltsstoffe der Präparate sowie frühere oder bestehende Krebserkrankungen der Leber.
Die Prognose hängt vor allem von der Ursache ab. Lässt sich diese gut behandeln und führen die Betroffenen regelmäßig Sexualhormone zu, können die
Geschlechtsmerkmale in der Regel wiederhergestellt werden. Auch möglichen Folgeerkrankungen, die durch den Hormonmangel bedingt auftreten können, kann so vorgebeugt werden.