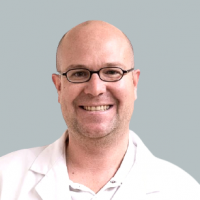Korrekterweise müssten Analthrombosen als Analvenenthrombosen bezeichnet werden, die gängige Abkürzung unter Medizinern ist aber die Analthrombose.
Am Darmausgang (medizinisch dem Analkanal) befinden sich Blutgefäße, über die das verbrauchte Blut wieder zum Herzen transportiert wird.
Wie die Venen in den Beinen, sind auch diese häufig erweitert und bilden Krampfadern. Kommt es in diesen Gefäßaussackungen zu einem Blutstau, kann sich ein Blutgerinnsel (Thrombus) bilden, welches die Vene verstopft. Durch das angesammelte Blut entsteht innerhalb von Minuten bis wenigen Stunden eine Schwellung. Die knötchenartige Schwellung kann erbsen- bis pflaumengroß werden und sehr schmerzhaft sein.
Mediziner sprechen in diesem Fall von einer Analthrombose (auch Perianal- bzw. Analvenenthrombose).
Die Analthrombose sowie Hämorrhoiden haben gemeinsam, dass es sich bei beiden um Erkrankungen des Analkanals handelt. Analthrombosen werden häufig mit Hämorrhoiden verwechselt, haben mit diesen aber nichts zu tun.
Bei Hämorrhoiden handelt es sich um Schleimhautausstülpungen des Analkanals, bei Analthrombosen um Gerinnselbildungen in Analkanalvenen. Wenn es durch Hämorrhoiden zu einem Abstromhindernis in Analkanalvenen kommt, besteht hier das Risiko der Ausbildung einer Analthrombose. Und wenn es umgekehrt durch die Analthrombose zu einer Aussackung und Ausstülpung der Schleimhaut kommt, können sich hieraus Hämorrhoiden entwickeln.
Folgende Faktoren begünstigen ebenfalls die Entstehung einer Analthrombose:
- starker Druckaufbau im Unterbauch:
- Dies ist der Fall während des Hustens, z.B. bei Patienten mit chronischem Asthma und Hustenanfällen. Aber auch Raucher sind häufiger betroffen.
- Auch verstärktes Pressen während des Stuhlgangs kann eine Analthrombose verursachen, folglich sind Patienten mit chronischer Verstopfung besonders gefährdet.
- Letztlich ist auch die Geburt und Entbindung eine Risikosituation, da durch das starke Pressen typischerweise Analthrombosen entstehen können. Es handelt sich hierbei um eine häufig beobachtete Komplikation unter der Geburt.
- langes, angespanntes Sitzen auf kalter Unterlage
- feuchtwarmes Klima
- hoher Alkohol- und Kaffeekonsum
- häufiger Verzehr scharfer Gewürze
- Durchfall und Verstopfung
- Analsex
- Stress
Analthrombosen gehen im Gegensatz zu tiefen Beinvenenthrombosen von oberflächlichen Venen aus. Sie sind daher harmlos. Das Gefährlichste an Thrombosen der tiefen Beinvenen ist eine Lungenembolie, die tödlich verlaufen kann. Bei Thrombosen der oberflächlichen Venen, z.B. auch bei Krampfadern an den Beinen, aber eben auch der Analvenenthrombose, werden Lungenembolien in aller Regel nicht beobachtet. Analthrombosen sind daher eine harmlose Erkrankung, auch wenn sie mitunter extrem schmerzhaft sein können.

Analthrombose (blau gepunktet) © Armin Kübelbeck, CC-BY-SA, Wikimedia Commons
Eine Analthrombose zeigt sich vor allem anhand
- plötzlich auftretender Schmerzen am Anus (Darmausgang), welche das Sitzen unmöglich machen,
- eines massiven Druck- bzw. Fremdkörpergefühls im Bereich des Darmausgangs,
- bläulicher Knoten am Anus ,
- Schwellungen sowie
- Blutabgang (insbesondere wenn Analthrombosen platzen).
Zudem leiden Betroffene häufig an
- Juckreiz,
- Stechen oder
- Brennen
am Anus.
Analthrombosen können normalerweise durch eine körperliche Untersuchung diagnostiziert werden. Der bzw. die prall-elastischen, bläulich verfärbten Knoten sind äußerlich gut sichtbar und bei Berührung schmerzhaft. Es handelt sich bei Analthrombosen, wie bei den meisten anderen Erkrankungen des Analbereichs, um eine Blickdiagnose. Allerdings gilt auch hier die Empfehlung, zusätzliche Erkrankungen auszuschließen.
Bei erträglichen Schmerzen kann zusätzlich eine Tast-Untersuchung des Afters erfolgen, um innenliegende Hämorrhoiden nachzuweisen oder auszuschließen.
Da sich hinter jedem Blutabgang aus dem Darm auch eine bösartige Tumorerkrankung „verstecken“ kann, sollte nach Abklingen der Schmerzen und Rückgang der Schwellung zusätzlich noch eine Darmspiegelung durchgeführt werden.
Analthrombosen sind zwar harmlos, aber in aller Regel äußerst schmerzhaft. Zur Linderung der Schmerzen und Reduzierung der Schwellung können Sie ein Kältepack verwenden.
Um der Haut Elastizität zu verleihen, bieten sich zudem Fettsalben wie Melkfett oder Vaseline an.
Meistens heilen die harmlosen Thrombosen nach zwei bis drei Wochen von selbst ab. Sie können den Abheilungsprozess fördern:
Stellen Sie einen weichen (nicht flüssigen) Stuhlgang sicher, indem Sie beispielsweise
- Weizenkleie,
- Flohsamen oder
- Leinsamen
einnehmen. Nehmen Sie hierzu ein bis zwei Esslöffel mit ausreichend Wasser ein. Abführmittel beeinträchtigen dagegen die Darmtätigkeit und schaden daher eher!
Reinigen Sie den After nach dem Stuhlgang mit Wasser. Dazu können Sie den After abduschen und anschließend mit einem weichen Handtuch trocken tupfen. Das Abreiben des betroffenen Bereichs kann die Schwellung zusätzlich reizen.
Vermeiden Sie Belastungen, die zu einem Druckaufbau im Unterbauch führen. Hierzu gehören vor allem schweres Heben und starkes Pressen während des Toilettengangs.
Zur Behandlung von Analthrombosen stehen konservative (ohne Operation) und operative Maßnahmen zur Verfügung. Ziele der konservativen Methoden sind:
- Schmerzreduktion
- Abschwellung
- Eröffnung und Entfernung des Gerinnsels
- Auflösen des Gerinnsels
- Verhinderung eines Rezidivs (Wiederauftreten)
Konservative Verfahren können als alleinige Therapiemaßnahme dienen, aber auch zusätzlich zur Operation angewendet werden. Insbesondere die medikamentöse Schmerztherapie sowie die Anwendung von Salben gehören zur postoperativen Nachbehandlung dazu.
Die Salbenanwendung ist der Hauptbestandteil der konservativen Therapie. Es handelt sich hierbei auch um eine sogenannte „lokale“ Therapie, was so viel wie „an Ort und Stelle“ bedeutet. Salben mit einem örtlich betäubenden Wirkstoff wie Lidocain helfen bei einer Analthrombose. Sie lindern die Schmerzen und beschleunigen damit den Abbau des Gerinnsels.
Zusätzlich können schmerzlindernde und entzündungshemmende Salben eingesetzt werden. Hierzu gehören insbesondere Diclofenac-haltige (nichtsteroidales Antirheumatikum) Salben. Auch Heparinhaltige Salben werden oft verschrieben, um den Abbau des Gerinnsels zu beschleunigen.
Auch Salben mit einem Kortikosteroid (Kortison) lindern die Schmerzen. Außerdem wird hierdurch eine Abnahme der Schwellung erreicht. Diese können aber bei langfristiger Anwendung die empfindliche Analkanalhaut schädigen. Daher sollten sie lediglich kurzfristig verwendet werden.
Bei äußerst schmerzhaften Analthrombosen werden zusätzlich zur Salbenanwendung noch eine „systemische“ Therapie empfohlen und oft notwendig. Systemisch bedeutet, im Vergleich zu lokal, dass die Therapie im gesamten Körper wirkt und als Tablette oder Infusion zugeführt wird. Schmerzstillende, entzündungshemmende sowie Gerinnsel auflösende Medikamente werden hierbei bevorzugt eingesetzt. Die Inhaltsstoffe ähneln den lokal angewendeten Salben, es handelt sich um nichtsteroidale Antirheumatika wie Ibuprofen, Kortison sowie Heparin.
In Ausnahmefällen kann eine Entfernung der Analthrombose unter lokaler Betäubung in Betracht gezogen werden. Eine OP kann bei sehr großen, äußerst schmerzhaften Analthrombosen notwendig werden.
Der Eingriff wird ambulant von einem Proktologen oder Chirurgen durchgeführt. Dabei stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung:
- Zum einen kann mithilfe eines Skalpells das Blutgerinnsel eröffnet werden (Stichinzision). Mittels Ausübung von Druck entleert er das Gerinnsel (Exprimierung). Allerdings ist das Blutgerinnsel von der erweiterten Gefäßwand der Vene umgeben und bildet mit dieser eine Kapsel. Deshalb füllt sich die Gefäßaussackung häufig erneut mit Blut.
- Daher kommt nicht selten eine zweite Methode zum Einsatz, um eine Rethrombosierung zu vermeiden. Hierbei wird das gesamte thrombotische Areal mit dem betroffenen Gefäßsegment entfernt (Exzision des Blutgerinnsels). Hierzu wird zunächst ein kleiner Schnitt durchgeführt, anschließend mit einer chirurgischen Schere das Blutgerinnsel inklusive der Kapsel entfernt. Danach wird eine sorgfältige Blutstillung durchgeführt und die Wunde verschlossen. Abschließend wird noch ein feuchter Verband mit abschwellender schmerzstillender Salbe angelegt.
Wie sieht die Nachbehandlung aus?
Viele empfinden die Wundheilungsschmerzen als deutlich erträglicher als die thrombosebedingten Schmerzen. Die zumeist leichten Schmerzen lassen sich sehr gut mit Schmerzmitteln kontrollieren.
Etwa eine Woche lang bedarf die Wunde nach der Operation einer besonderen Pflege. Sie muss nach jedem Stuhlgang und vor dem Zubettgehen mit Wasser ausgeduscht werden. Ist dies nicht möglich, sollte ein feuchter Verband angelegt werden, der ein Desinfektionsmittel und eine Salbe enthält.
Viele Patienten können bereits einen Tag nach dem Eingriff wieder zur Arbeit gehen. Nach zwei bis drei Wochen sollte die Wunde vollständig geschlossen und abgeheilt sein.
Was sind typische Komplikationen nach der Operation einer Analthrombose?
Generell sind nach der chirurgischen Entfernung einer Analthrombose keine größeren Komplikationen zu erwarten.
In einigen Fällen blutet es aus den Wunden nach. Leichte Nachblutungen stoppen dabei in aller Regel von allein. Ist dies nicht der Fall, kann eine erneute Operation notwendig werden. Hierbei muss das nachblutende Gefäß erneut mit Strom verschlossen oder gegebenenfalls vernäht werden. Sollte sich die Wunde infizieren und ein Abszess mit Eiteransammlung entstehen, kann eine chirurgische Eröffnung der Eiteransammlung notwendig werden, zudem ist dann auch häufig eine Antibiotikatherapie nötig.
In äußerst seltenen Fällen heilt die Wunde schlecht ab, sodass sich ein chronischer Afterriss (sogenannte Analfissur) entwickelt. Dieser kann sehr schmerzhaft sein und muss entsprechend behandelt werden.