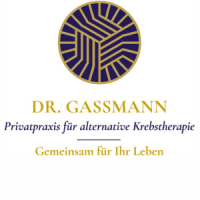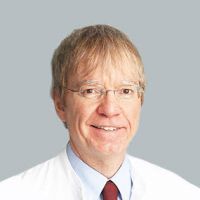Krebs ist eine gefürchtete Krankheit, die das Leben der Betroffenen auf den Kopf stellen kann. Dazu gehört eine sorgfältige Tumordiagnostik: Sie sichert nicht nur die Diagnose, sondern stellt auch den Schweregrad des Tumors fest. In dieser überfordernden Zeit haben Betroffene viele Fragen und suchen nach verlässlichen, verständlichen Informationen. Daher soll dieser Text einen Überblick über die verschiedenen Untersuchungen in der Tumordiagnostik, ihren Zweck und ihre Risiken geben. Finden Sie hier außerdem ausgewählte Spezialisten für Tumordiagnostik.
Empfohlene Spezialisten für Tumordiagnostik
Artikelübersicht
Was bedeutet Tumordiagnostik?
Das Ziel der Tumordiagnostik ist es, einem Krebsverdacht nachzugehen und die Eigenschaften eines Tumors genauer zu bestimmen. Merkmale wie
- Größe,
- Form und
- Ausdehnung
eines Tumors sind ausschlaggebend für die Wahl der Therapieform.
Mithilfe unterschiedlicher Methoden suchen Spezialisten nach Metastasen, also Tochtergeschwülsten in Lymphknoten oder anderen Geweben. Liegen bereits Metastasen vor, ist die Prognose schlechter. Daher ist eine möglichst frühe Entdeckung des Tumors entscheidend.
Je nach Krebsart unterscheidet sich der Ablauf von Erstkonsultation bis zur endgültigen Diagnose. Meist kommen Patienten zum Arzt, weil sie konkrete Beschwerden haben und befürchten, an Krebs zu leiden. Mitunter führt auch eine Routineuntersuchung zur Entdeckung eines Tumors.
Zu Beginn der Diagnostik steht die Anamnese. Dabei schildert der Patient die Symptome und seine bisherige Krankengeschichte. Danach folgt eine Überweisung zu einer bildgebenden Untersuchung. Parallel veranlasst der Arzt eine Blutuntersuchung, bei der nach sogenannten Tumormarkern gesucht wird. Das sind Substanzen, die erste Hinweise auf die Art des Tumors geben können. Oft ist zur Sicherung der Diagnose eine Biopsie notwendig. Dabei wird mithilfe einer Nadel oder spezieller Apparate ein kleines Stück des Tumors entnommen und unter dem Mikroskop untersucht.
Onkologen sammeln alle Befunde und legen danach die Therapie fest.
Welche Methoden gibt es in der Tumordiagnostik?
Radiologen und die bildgebenden Verfahren
Einen großen Stellenwert in der Krebsdiagnostik nehmen bildgebende Verfahren ein. Darunter fallen
- das klassische Röntgen,
- der einfache Ultraschall,
- das schnelle CT,
- das aufwändigere MRT und
- spezielle nuklearmedizinische Untersuchungen.
Dieses Feld ist die Domäne der Radiologen und Nuklearmediziner.
Beim Röntgen wird der Körper mit Strahlen durchleuchtet und es entsteht ein zweidimensionales Bild in Graustufen. So erhält der Radiologe einen ersten Überblick über die Lage und Größe des Tumors. Für Patienten ist diese Methode unkompliziert und wenig belastend.
Auch die Durchleuchtung mit Ultraschallwellen liefert ein Bild der tieferen Körperschichten. Von Knochen umgebene Strukturen, also zum Beispiel das Gehirn, können mittels Ultraschall nicht abgebildet werden. Diese Methode ist daher auf bestimmte Krebsarten in Weichteilen wie der Schilddrüse beschränkt. Dafür kommt sie ohne Strahlenbelastung aus und ist beinahe überall schnell verfügbar.
Die Computertomographie (CT) ist im Prinzip eine Serie von Röntgenbildern, die übereinander gelagert werden. So entsteht ein dreidimensionales Bild, das die genaue Ausdehnung des Tumors zeigt. Die Strahlenbelastung ist relativ hoch, daher wird das CT bei Kindern oder Schwangeren nur zurückhaltend eingesetzt.
Bei der Magnetresonanztomographie (MRT) erzeugen wechselnde Magnetfelder dreidimensionale Schnittbilder des Körpers. Diese Methode liefert ausgezeichnete Bilder von fast allen Körperregionen. Im Gegensatz zum CT werden hier keine Röntgenstrahlen benötigt. Dafür dauert die Untersuchung länger. Manche Patienten mit Platzangst empfinden sie außerdem als belastend.

Bildgebende Untersuchungen, etwa MRT und CT, gehören zu den wichtigsten Verfahren der Tumordiagnostik © Gorodenkoff | AdobeStock
Unbekannter sind die nuklearmedizinischen Verfahren, die bei manchen Krebsarten große Aussagekraft haben. Die Kombination aus einer bildgebenden Methode und speziellen radioaktiven Kontrastmitteln ermöglicht die Beurteilung der Funktion und des Stoffwechsel eines Tumors.
Besonders geeignet sind diese Untersuchungen für Tumoren und Metastasen in
- Knochen,
- Schilddrüse und
- Gehirn.
Radioaktivität weckt oft Ängste bei Patienten, dabei ist die Strahlenbelastung meist sogar geringer als bei einer Computertomographie.
Labormediziner untersuchen das Blut
Eine Blutabnahme mit anschließender Analyse im Labor ist immer Teil der Krebsdiagnostik. Onkologen gewinnen dadurch wertvolle Informationen, sowohl zum Tumor selbst als auch zum Allgemeinzustand des Patienten.
Die sogenannten Tumormarker sind Substanzen, die bei bestimmten Krebserkrankungen im Blut auftreten. Manchmal führen jedoch auch andere Krankheiten zum Anstieg dieser Werte. Erhöhte Tumormarker liefern daher erste Hinweise, sind alleine jedoch nicht ausreichend für eine definitive Diagnose. Gut geeignet sind sie dagegen für die Verlaufskontrolle, denn sie geben oft als erstes Aufschluss über einen möglichen Rückfall.
Beispiele für spezifische Tumormarker sind
- das karzinoembryonale Antigen (CEA) bei Dickdarmkrebs,
- das prostataspezifische Antigen (PSA) bei Prostatakrebs und
- das Alpha-Fetoprotein (AFP) bei Tumoren der Leber.
Während der Blutuntersuchung ermitteln die Mediziner routinemäßig auch
- die Anzahl der Blutkörperchen,
- die Leber- und Nierenwerte und
- zahlreiche andere Parameter.
Pathologen untersuchen Gewebe mikroskopisch
Der letzte Schritt in der Tumordiagnostik ist häufig eine Biopsie. Dabei entnimmt der Arzt eine Gewebeprobe des Tumors und lässt ihn von Pathologen mikroskopisch untersuchen. Nur so können Pathologen mit Sicherheit bestimmen, ob der Tumor gut- oder bösartig ist.
Der Ablauf der Biopsie unterscheidet sich je nach Lage und Art des Tumors. Meistens entnimmt der Arzt mit einer speziellen Nadel unter lokaler Betäubung etwas Tumorgewebe. Bei manchen Krebsformen werden auch
- Stanzgeräte,
- elektrische Schlingen oder
- Laser
eingesetzt. Um die Präzision zu erhöhen, arbeiten Ärzte oft unter Sichtkontrolle durch Ultraschall oder Röntgen. Durch die lokale Betäubung spüren Patienten bei dem Eingriff keine Schmerzen. Selten kommt es nach einer Biopsie zu größeren Blutungen oder Infektionen, das Risiko ist jedoch gering.
Ein bösartiger Tumor wächst in umliegende Gewebe ein. Das wird als invasives Wachstum bezeichnet und beeinflusst maßgeblich die Prognose. Aussehen und Reifegrad der Zellen geben Hinweise auf die genaue Krebsart. Diese Erkenntnisse beeinflussen die spätere Auswahl der Medikamente und anderer Therapieformen.
Spezielle molekularbiologische Methoden machen es möglich, Mutationen der Krebszellen festzustellen. Mutationen sind genetische Veränderungen. Dadurch können bösartige Zellen beispielsweise ungehindertes Wachstum und Widerstandsfähigkeit gegenüber Medikamenten erhalten. Mit diesem Wissen kann die Behandlung optimiert werden.
Was passiert danach?
Wenn Bildgebungen, Blutbefunde und molekularbiologische Nachweise ausgewertet vorliegen, setzen sich Ärzte verschiedener Fachrichtungen in einem Tumorboard zusammen. So wird die Fachkonferenz bezeichnet, die aus
- Radiologen,
- Pathologen,
- Onkologen und
- Chirurgen
besteht. Das Fachpersonal bespricht dort die weitere Vorgangsweise und wählt die geeigneten Therapien individuell aus.
Der behandelnde Arzt klärt den Patienten über die geplanten Behandlungen, deren Chancen und Risiken auf. Auch die psychosoziale Betreuung darf in dieser schwierigen Situation nicht zu kurz kommen. Viele Krankenhäuser bieten daher Kontakt zu Selbsthilfegruppen an.
Quellen
- https://www.krebsinformationsdienst.de/untersuchung/index.php
- https://www.krebsgesellschaft.de/basis-informationen-krebs/diagnosemethoden.html
- Leischner, Hannes. Basics Onkologie. 3. Aufl.. ed. 2014. Print. Basics.