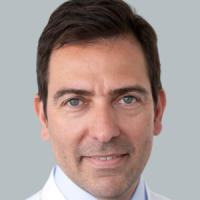Die optimale Funktion des menschlichen Organismus basiert unter anderem auf einer gesunden Schilddrüse. Die Schilddrüsenhormone sind an vielen Stoffwechselvorgängen beteiligt.
Schilddrüsenerkrankungen sind jedoch weit verbreitet und treten mitunter schon im Kindes- und Jugendalter auf. Vor allem Autoimmunerkrankungen wie
treten immer häufiger auf und verursachen meist massive Störungen des gesamten Stoffwechsels. Unbehandelt können sie sogar zu schweren gesundheitlichen Schäden führen.
Liegt der Verdacht einer Schilddrüsenerkrankung nahe, sind verschiedene Untersuchungen notwendig. Die Schilddrüsendiagnostik umfasst sämtliche Maßnahmen zur Feststellung von Erkrankungen des Organs.
Bei folgenden Problemen ist eine Untersuchung der Schilddrüse angezeigt:

Die Schilddrüse ist ein wichtiges Organ, das an der Vorderseite des Halses sitzt © SciePro | AdobeStock
Im Rahmen der Schilddrüsendiagnostik werden folgende Verfahren eingesetzt:
- Laboruntersuchungen, vor allem der Blutwerte,
- Schilddrüsensonographie,
- Schilddrüsenszintigraphie,
- Feinnadelpunktion.
Zur Diagnostik gehört auch eine umfassende Anamnese. Dabei befragt Sie der Arzt nach
Laboruntersuchung
Der Arzt nimmt Blut ab, das im Labor untersucht wird. Dabei werden folgende Parameter bestimmt:
- TSH (Hormon zur Schilddrüsenstimulierung),
- T3 (Trijodthyronin),
- T4 (Thyroxin),
- TRH-Test (Nachweis einer Schilddrüsenhormonresistenz),
- Schilddrüsenantikörper (z. B. TSH-Rezeptor-Antikörper, Antikörper gegen Thyreoglobulin, Antikörper gegen Schilddrüsenperoxidase. Bestimmung erfolgt bei Verdacht auf Unter- oder Überfunktion der Schilddrüse),
- Thyreoglobulin (Bestimmung bei Verdacht auf Schilddrüsenkarzinom oder bestimmte Funktionsstörungen),
- Kalzitonin (Bestimmung bei Verdacht auf Schilddrüsenkarzinom),
- Jodbestimmung im Urin (bei Verdacht auf Jodkontamination).
Zur Früherkennung möglicher Komplikationen, die aus einer Schilddrüsenerkrankung resultieren können, dienen folgende Werte:
- Cholesterin,
- Blutdruck und Puls,
- Entzündungswerte,
- Leber- und Nierenwerte,
- Fett- sowie Wassereinlagerungen.
Ultraschall (Schilddrüsensonographie)
Bei der Schilddrüsendiagnostik spielt der Ultraschall (Sonographie) eine wichtige Rolle. Das bildgebende Verfahren zeigt bei Verdacht auf eine Erkrankung der Schilddrüse mögliche strukturelle Veränderungen des Organs.
Die Untersuchung wird mit einem hochfrequenten Schallkopf durchgeführt und ist absolut schmerzfrei.
Durch die Schilddrüsensonographie kann der Arzt
- Form,
- Lage,
- Größe,
- Volumen und
- Knoten
exakt beurteilen. Schon eine Schilddrüsenentzündung lässt sich im Ultraschall gut darstellen.
Schilddrüsenszintigraphie
Die Szintigraphie ist ein nuklearmedizinisches Verfahren, bei dem radioaktiv markiertes Jod zum Einsatz kommt.
Eine Schilddrüsenszinitgraphie wird zum Ausschluss von Schilddrüsenkrebs angewendet. Sie gibt auch Aufschluss über die Nuklidspeicherung in einzelnen Bereichen der Schilddrüse sowie über die gesamte Leistungsfähigkeit des Organs. Somit kann auch die Schilddrüsenszintigraphie die Struktur der Schilddrüse darstellen.
Mitunter erfolgt im Anschluss noch eine so genannte Suppressionsszintigraphie. Dabei wird der hormonelle Regelkreis der Hypophyse überprüft. Durch die Gabe von Schilddrüsenhormonen erzeugt der Mediziner künstlich eine kurzfristige Überfunktion. In der Folge sinkt die TSH-Ausschüttung und im Szintigramm lässt sich eine verminderte Radionuklidaufnahme des normalen Schilddrüsengewebes erkennen.
Feinnadelpunktion
Mittels Feinnadelpunktion erfolgt auf schonende Weise eine Gewebeentnahme aus der Schilddrüse.
Bei dieser Untersuchungsmethode entnimmt der Arzt mit einer kleinen, sehr dünnen Nadel direkt durch die Haut ein wenig Schilddrüsengewebe. Die Prozedur ist fast schmerzfrei und dauert nur wenige Sekunden.
Zur Vorbeugung eines Blutergusses, der mit einem Druckgefühl einhergehen kann, ist nach der Punktion eine gute Kompression von großer Bedeutung. Die Feinnadelpunktion kann ultraschallgestützt durchgeführt werden, wenn eine Fixierung des zu punktierenden Knotens mit dem Finger nicht möglich ist.
Das entnommene Gewebe wird anschließend auf ein Glasplättchen aufgetragen. Ein Pathologe untersucht die Zellen mithilfe eines Mikroskops.
Weitere Verfahren zur Diagnose möglicher Schilddrüsenerkrankungen
In der Regel sind die bereits erwähnten diagnostischen Verfahren ausreichend. Nur selten kommen weitere bildgebende Verfahren zum Einsatz.
Bei der Ausbildung eines größeren Kropfes könnte die Luftröhre verengt sein. Durch eine Röntgenuntersuchung des Halses lässt sich feststellen, ob eine Verengung vorliegt und wie stark sie ausgeprägt ist.
Nur sehr selten ist ein MRT (Magnetresonanztomographie) notwendig.
Reicht die Schilddrüse bis in den Brustkorb hinein und ist eine Operation erforderlich, sollte im Vorfeld des Eingriffs eine Computertomographie (CT) durchgeführt werden.
Haben Sie den Verdacht, dass Sie an einer Erkrankung der Schilddrüse leiden, ist Ihr Hausarzt der erste Ansprechpartner. Dieser führt zunächst eine Anamnese (Befragung) durch. Erhärtet sich der Verdacht, wird er Sie an einen Internisten mit dem Fachgebiet der Inneren Medizin überweisen.
Üblicherweise wird dann auch ein Facharzt für Endokrinologie, also ein Spezialist für Drüsen und Hormone, hinzugezogen. Endokrinologen sind ebenfalls Fachärzte für Innere Medizin. Sie haben sich auf die Diagnose und Behandlung von Drüsen und Hormonerkrankungen spezialisiert. Das macht sie auch zu Spezialisten für die Schilddrüse.
Diagnoseverfahren führen zudem auch Fachärzte für Nuklearmedizin durch.