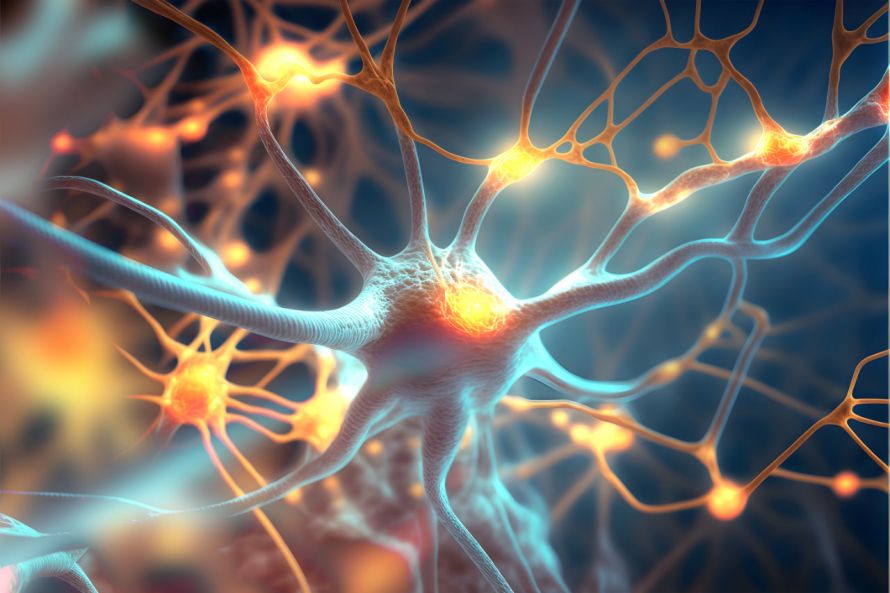Die Neurostimulation ist als schmerztherapeutisches Verfahren seit Ende der sechziger Jahre bekannt. Seit den 80er Jahren kommt die Methode standardmäßig in der Schmerztherapie chronischer Schmerzen zum Einsatz.
Vor allem chronische Schmerzen eignen sich zur Behandlung mittels Neurostimulation. Als chronisch bezeichnet man Schmerzen, die länger als sechs Monate anhalten oder in diesem Zeitraum immer wiederkehren. Häufige Einsatzgebiete sind
- Rücken,
- Nacken,
- Arme und
- Beine.
Neurostimulation wird auch als Rückenmarkstimulation (SCS: Spinal Cord Stimulation) bezeichnet. Das Verfahren entspricht einer Nervenstimulation mittels Stromimpuls.
Schmerzsignale erreichen das Gehirn über das Rückenmark. Neurostimulatoren beeinflussen diesen Prozess.
Die Reizleitung kann sowohl in efferente als auch afferente Richtung erfolgen:
- Efferent: Impulse werden aus dem zentralen Nervensystem in die Peripherie gesandt.
- Afferent: Impulsleitung aus der Peripherie ins Zentralnervensystem.
Die auriculare Neurostimulation entspricht einem minimal-invasiven Behandlungsverfahren zur Implantation eines Stimulationssystems. Dieses System blockiert die Weiterleitung von Schmerzreizen an afferenten Nervenästen. Die Schmerzempfindung wird damit abgefangen, bevor sie ins Bewusstsein übertritt.
Spezialisten für die Neurostimulation sind Schmerzmediziner, Neurochirurgen und Wirbelsäulenchirurgen.
Neurostimulatoren hemmen die Erregungsleitung von überaktiven Nerven mittels eines Impulsgebers. Dieser elektronische Impulsgeber entspricht einem Neuromodulator oder Neurostimulator. Das Gerät regt einzelne Abschnitte des Rückenmarks durch schwach elektrische Impulse an.
Der Neuromodulator kommuniziert mit einer Elektrode. Dieser dünne Draht sitzt im Wirbelkanal des Schmerzerkrankten und gibt die ihm zugesandten Impulse an die Nerven des Rückenmarks weiter.
Durch diese Impulse überlagert die Neurostimulation die Schmerzleitung einzelner Nerven, bevor das Schmerzsignal das Gehirn erreicht. Statt Schmerzen empfindet der Patient ein angenehmes Kribbeln im ehemaligen Schmerzgebiet.
Um ihre Eignung für Neurostimulation zu ermitteln, erhalten Patienten vor der geplanten Implantation eines Neurostimulators einen externen Stimulator. Nach einer Testphase kann bei entsprechender Eignung die Implantation des Elektroden-Empfängersystems (SCS-System) erfolgen.
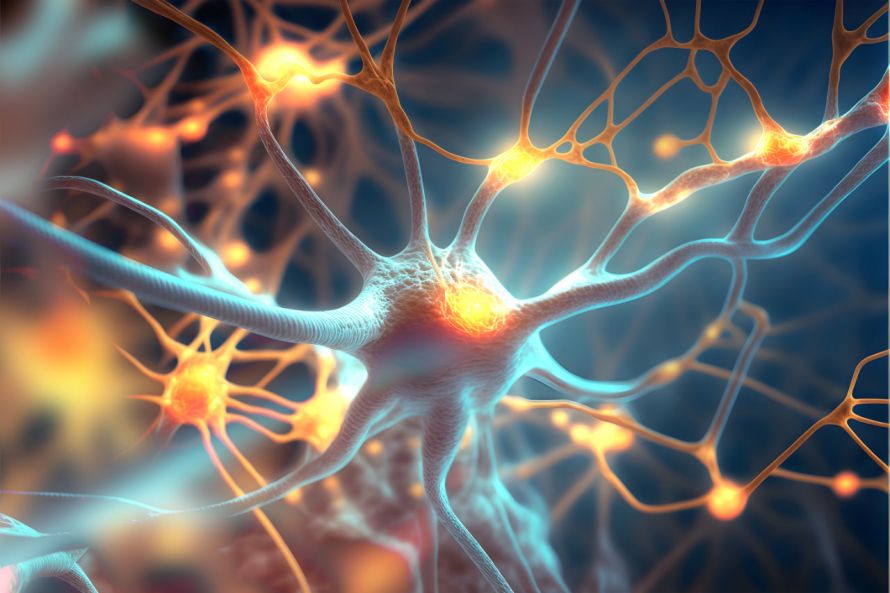
Die Neurostimulation macht sich das Nervensystem zunutze und fängt Schmerzimpulse ab, bevor sie das Gehirn erreichen © C.Castilla | AdobeStock
In der Schmerztherapie werden unterschiedliche Arten des Neurostimulators eingesetzt. Neben implantierbaren Stimulatoren existieren externe Neurostimulatoren.
Der Stimulator weist etwa die Größe einer Zigarettenschachtel auf und enthält
- Hochleistungselektronik,
- Batterien sowie
- mehrpolige Elektroden.
Der Neurostimulator versorgt die Elektrode mit Impulsen. Die Elektrode ist für die Impulsweiterleitung an die entsprechenden Nerven zuständig.
Der Arzt programmiert implantierbare Neurostimulatoren im Anschluss an die Implantation. Danach kann der Patient den Neurostimulator ein- und ausschalten und die Impulse in ärztlich vordefinierten Grenzen abändern. So passt er die Stimulation an die die aktuelle Schmerzsymptomatik an.
Grundsätzlich eignet sich die Neurostimulation vor allem bei Indikationen wie
- chronischen Schmerzen im Bereich des Rückens, des Nackens oder der Gliedmaßen
- neuropathischen Schmerzen mit Brennen oder Taubheitsgefühl oder
- geringfügiger Schmerzlinderung durch konventionelle Verfahren wie Physiotherapie oder Schmerzmittel.
Die Neurostimulation stößt vermutlich anti-entzündliche Prozesse an. Außerdem greift sie über sensorische Pfade in die Mikrodurchblutung ein.
Klinische Untersuchungen belegen die Wirksamkeit der Nervenstimulation daher im Rahmen von chronischen Krankheiten wie
Wie klinische Studien belegen, lindert die Neurostimulation chronische Schmerzen um bis zu 50 Prozent. Diese Schmerzlinderung ermöglicht die schmerzlose Bewegung und fördert so die Aktivität. Damit steigt durch Neurostimulation bei chronischen Erkrankungen die Lebensqualität.
Durch den schmerzlindernden Effekt greifen die Patienten nur noch wenig oder überhaupt nicht mehr auf Schmerzmittel zurück. Auf diese Weise reduziert die Neuromodulation mittels Neurostimulator auch die Nebenwirkungen, die mit Medikamenteneinnahme verbunden sind.
Vorteile der Neurostimulation
Gegenüber anderen Verfahren zeigt das neuromodulative Behandlungsverfahren mit Stimulator viele Vorteile. Eine Neurostimulation
- lindert Schmerzen,
- reduziert die Notwendigkeit von Schmerzmitteln,
- verbessert die Lebensqualität,
- kann in einer Testphase ausprobiert werden,
- kann rückgängig gemacht werden,
- verändert die Nervenleitung oder das Rückenmark nicht dauerhaft,
- lässt sich individuell anpassen.
Risiken und Nebenwirkungen von Neurostimulation
Wie jedes Behandlungsverfahren ist die Neurostimulation mit einigen Risiken und Nebenwirkungen verbunden.
- Die Elektrode kann verrutschen.
- Die Schmerzlinderung kann durch falsch platzierte Elektroden ausbleiben.
- Im Stimulationsbereich können unangenehme Empfindungen auftreten.
Da das Behandlungsverfahren eine Operation erfordert, bestehen außerdem die üblichen Operationsrisiken. In seltensten Fällen
- bilden sich Hämatome (Blutergüsse) oder Serome (Flüssigkeitsansammlungen) an der Implantationsstelle,
- wird das Rückenmark bei dem Eingriff verletzt,
- kommt es zu Infektionen der Wunde,
- fallen komplikationsbedingt mehrere Operationen an.
Der behandelnde Arzt wiegt Risiken und Nutzen im Einzelfall gegeneinander ab und entscheidet so über die Eignung des Patienten.