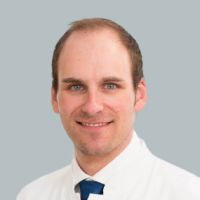Empfohlene Spezialisten
Artikelübersicht
Die Patella und Ursachen für eine Patellafraktur
Die Kniescheibe (Patella) ist ein Teil des Streckapparats am Knie. Sie bildet auf Höhe des Kniegelenks eine Umlenkung der Streckmuskulatur zum Unterschenkel. Sie ist damit wesentlich bei der aktiven Streckung des Kniegelenks beteiligt.
Die Patella verhindert, dass die Sehne der Oberschenkel-Streckmuskulatur direkt auf dem Kniegelenk reibt. Sie gleitet auf einer entsprechenden Rinne des Oberschenkelknochens.
Der Verletzungsmechanismus bei einer Patellafraktur ist in der Regel ein Sturz auf die Kniescheibe oder ein heftiges Anpralltrauma.
Symptome und Diagnose beim Kniescheibenbruch
Eine Patellafraktur geht einher mit starken Schmerzen auf der Vorderseite des Kniegelenkes und direkt über der Kniescheibe.
Meist tritt auch eine deutliche Schwellung des Kniegelenks auf. Typisch ist, dass der Unterschenkel nicht aktiv gestreckt beziehungsweise das Kniegelenk nicht gestreckt gehalten werden kann.
Die eindeutige Diagnose kann durch Röntgenaufnahmen gestellt werden.

Das Kniegelenk. Die Patella befindet sich hier rechts im Bild unter den weiß dargestellten Muskelsträngen © Axel Kock | AdobeStock
Behandlung der Patellafraktur
Die Behandlung richtet sich nach
- der Art der Patellafraktur,
- der Anzahl der Bruchstücke,
- der Ausrichtung der Bruchlinie und
- dem Auseinanderweichen der Bruchstücke.
Die undislozierten stabilen Frakturen können prinzipiell konservativ behandelt werden.
Eine operative Versorgung ist indiziert bei dislozierten instabilen Frakturen. Eine Schienung und Ruhigstellung des betroffenen Kniegelenks ist immer von Nöten. Ein erhöhtes Risiko eines Blutgerinnsels (Thrombose) verpflichtet zur prophylaktischen Gabe von Antithrombosemitteln.
Im Rahmen einer operativen Versorgung werden die Bruchstücke durch Bohrdrähte oder Schrauben festgehalten. Eine spezielle Zug-Gurtung fängt die Zugkräfte auf (Cerclage).
Nachdem der Kniescheibenbruch ausgeheilt ist, ist es meist erforderlich, die Implantate in einer weiteren Operation zu entfernen.
Nachsorge bei einer Patellafraktur
Primär erfolgt eine Ruhigstellung des Kniegelenks mittels spezieller Schienen. Das Bein sollte nicht belastet werden und eine aktive Streckung ist zu vermeiden.
Mit einer physiotherapeutischen Nachbehandlung kann frühzeitig begonnen werden.
- schmerzorientierte Nachbehandlung mit axialer Vollbelastung in Streckstellung (Mecron Schiene)
- Röntgenkontrolle nach Belastung und nach 14 Tagen zum Ausschluss der sekundären Dislokation
- Bewegungslimitierung: 1.-3. Woche: Ext/Flex 0-0-30; 4.-6. Woche: Ext/Flex 0-0-60
Die Mobilisation nach operativer Therapie ist vom Ausmaß der Verletzung und dem Operationsverfahren abhängig. Osteosynthesen mit Schrauben und Zuggurtung können meist ebenfalls nach dem folgenden Schema mobilisiert werden:
- 1.-3. Woche: Ext/Flex 0-0-30
- 4.-6. Woche: Ext/Flex 0-0-60
Der Einsatz einer Motorschiene (CPM) ist hilfreich. Bei axialer Vollbelastung sind für die Gangschulung unbedingt Unterarmstützen zu benutzen, um den Streckapparat zu entlasten und die retropatellare Kompression zu reduzieren.

Nach der Behandlung einer Patellafraktur sind für eine gewisse Zeit Unterarmgestützen erforderlich © S Amelie Walter | AdobeStock
Heilungsaussichten nach einer Patellafraktur
Die Prognose bei einem unkomplizierten Verlauf eines Kniescheibenbruchs ist meist sehr gut und das betroffene Bein ist wieder uneingeschränkt einsatzfähig.
Gelegentliche treten Restbeschwerden wie Schwellneigung oder Wetterfühligkeit auf und können über mehrere Monate bestehen bleiben.
Als Langzeitfolge kann ein frühzeitiger Gelenkverschleiß im Gleitlager der Kniescheibe auftreten. Dies ist der Fall, wenn nach Trümmerbrüchen, trotz Operation, eine Unregelmäßigkeit des Knorpels an der Rückseite der Kniescheibe bestehen bleibt.
Medikamente bei einem Kniescheibenbruch
Eine initiale sowie postoperative lokale und systemische analgetische Therapie ist durchzuführen.